Unterversorgung vorprogrammiert: Studie belegt Defizite beim Thema Reizdarm im Medizinstudium
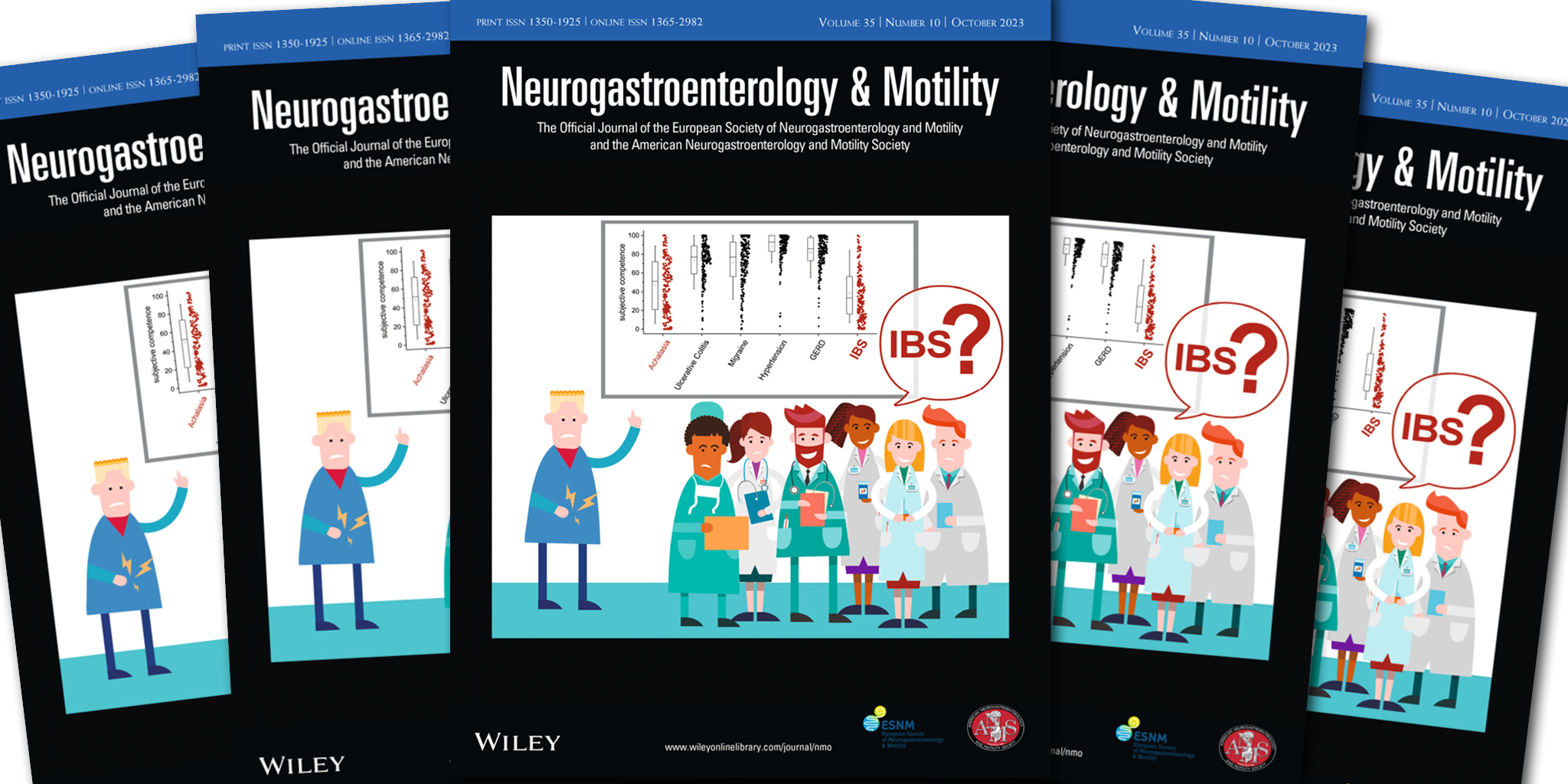
Medizinstudierende sind sehr unsicher im Umgang mit der Volkskrankheit Reizdarmsyndrom. Das zeigt eine von der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie (DGNM) initiierte Befragung. Für diese wurden an fünf Fakultäten in Deutschland Studierende kurz vor Ende ihres Studiums befragt und gebeten, ihr Selbstvertrauen in der Diagnostik und Therapie verschiedener chronischer Krankheiten anzugeben.
An allen Universitäten wurde nicht nur fehlende eigene Kompetenz, sondern auch eine Unterrepräsentation der Erkrankung in der Lehre angegeben. Hingegen sahen sich die Studierenden in Bezug auf Patienten mit Bluthochdruck, Refluxerkrankung oder der vergleichsweise seltenen und komplexen Colitis ulcerosa gut gerüstet. Ein übergroßer Anteil der angehenden Mediziner:innen gab an, dass es im Studium praktisch keine Lehrveranstaltungen zum Thema Reizdarmsyndrom gegeben habe. Die Studie wurde nun in der internationalen Fachzeitschrift "Neurogastroenterology and Motility" veröffentlicht und nimmt sogar prominent die Titelseite ein. Hierzu Robert Patejdl, 2. Vorsitzender der DGNM und Erstautor der Studie: "Das Reizdarmsyndrom braucht im Interesse von Millionen Patient:innen alleine in Deutschland endlich den Stellenwert im Medizinstudium, den es als einer der häufigsten Gründe für ärztliche Konsultationen überhaupt verdient."
Von 231 Teilnehmenden der Studie erinnerten sich nur 38 % daran, dass Neurogastroenterologie überhaupt explizit als Sachgebiet in ihrem Curriculum behandelt wurde. Die mangelnde Verankerung des Fachgebiets spiegelt sich auch in den subjektiven Kompetenzeinstufungen wider: Das größte Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten gaben die Studierenden für die Hypertonie an, die niedrigsten für das Reizdarmsyndrom und die Achalasie. Trotz der großen Komplexität war die subjektive Kompetenz bezüglich der Colitis ulcerosa und das Refluxsyndrom hoch, so dass das Ergebnis keine allgemeine Vernachlässigung der gesamten Gastroenterologie abbildet.
Diese Ergebnisse waren für die Studierenden aller fünf teilnehmenden Fakultäten unabhängig von ihrem Studienmodell identisch. Student:innen, die sich an die Neurogastroenterologie als Teil ihres Lehrplans erinnerten, gaben höhere Kompetenzbewertungen an. Nach Ansicht von 72 % der Studierenden sollten NGDs im Curriculum stärker hervorgehoben werden.
Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass die Neurogastroenterologie in den medizinischen Curricula trotz ihrer epidemiologischen Relevanz nur schwach vertreten ist und dies sich unmittelbar in einem geringen Maß an subjektiver Kompetenz im Management dieser Erkrankungen niederschlägt. Negative Auswirkungen dieses Zusammenhangs auf die Qualität der Versorgung der zukünftigen Patienten sind fast unvermeidlich und erklären die in Studien nachgewiesene Mängel.